Gestern hat das föderale Parlament das Gesetz zum Atomausstieg offiziell gekippt – ein Gesetz, das 2003 mit breiter politischer Unterstützung beschlossen wurde und eigentlich das Ende der Atomkraft in Belgien einleiten sollte. Die belgische Regierung verspricht nun, mit neuen Reaktoren niedrigere Strompreise und mehr Energieunabhängigkeit zu schaffen – doch ihre Entscheidungen führen in Wahrheit genau ins Gegenteil.
Mit dem Festhalten an alten Reaktoren und der vagen Hoffnung auf neue, milliardenteure Atomprojekte verkauft sie der Bevölkerung scheinbare Lösungen für echte Probleme. Und während über technische Details diskutiert wird, bleibt ein zentraler Aspekt weitgehend außen vor: die gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung. Die Verlängerung der Laufzeiten alter Reaktoren und die Planung neuer Atomkraftwerke sind nicht nur sicherheitstechnisch bedenklich, sondern auch wirtschaftlich unsinnig und behindern die dringend notwendige Energiewende.
Sicherheitsrisiken durch veraltete Reaktoren
Die Reaktoren Doel 4 und Tihange 3, deren Laufzeiten nun bis 2035 verlängert werden sollen, stammen aus den 1980er Jahren und sind somit über 50 Jahre alt, wenn sie tatsächlich weiterbetrieben werden. Besonders bemerkenswert: Selbst der Betreiber Engie spricht sich immer noch gegen eine Laufzeitverlängerung aus, da diese technisch und wirtschaftlich kaum vertretbar sei. Die jetzige politische Entscheidung ignoriert nicht nur die physikalische Realität der alternden Reaktoren, sondern auch die Einschätzung derjenigen, die sie betreiben sollen.
Hohe Kosten ohne wirtschaftlichen Nutzen
Die Laufzeitverlängerung und der Bau neuer Reaktoren erfordern öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe. Allein für die Nachrüstung der Altmeiler sind mehrere Milliarden Euro notwendig. Neue Anlagen – etwa sogenannte Small Modular Reactors – kosten nach aktuellen Schätzungen pro erzeugter Kilowattstunde ein Vielfaches von Wind- oder Solarenergie. Diese Investitionen belasten die Steuerzahler massiv und führen zu einem Strompreis, der langfristig deutlich teurer wird als der aus erneuerbaren Energien.
Abhängigkeit von ausländischem Brennstoff
Atomkraft schafft keine Unabhängigkeit. Im Gegenteil. Die neuen Reaktortypen, die derzeit diskutiert werden, brauchen spezielle Brennstoffe, die Belgien selbst gar nicht herstellen kann. Diese müssen importiert werden, oft aus Russland, das den Markt für diesen Brennstoff (hochangereichertes Uran, kurz HALEU) fast vollständig kontrolliert. Besonders bei den sogenannten „kleinen, modularen Reaktoren“ (SMRs) ist der Brennstoff fest an die Reaktortechnologie gekoppelt – er wird zusammen mit dem Reaktor geliefert. Das macht Belgien langfristig abhängig von ausländischen Anbietern und damit auch von deren politischen Interessen. Hat man denn aus der Vergangenheit nichts gelernt?
Ungeklärte Endlagerfrage
Bis heute gibt es in Belgien keine Lösung für die sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Das oberirdische Lager in Dessel ist nur für schwach- und mittelaktive Stoffe ausgelegt. Atommüll braucht bis zu einer Million Jahre, um auf ein ungefährliches Strahlungsniveau abzuklingen – das ist ein gigantischer und kaum planbarer Zeitraum. Was mit dem hochradioaktiven Müll geschehen soll, bleibt unklar. Klar ist, dass niemand in Belgien ein Atommüllendlager in seinem Garten haben möchte.
Keine kurzfristige Entlastung
Neue Reaktoren könnten frühestens in 20 bis 25 Jahren ans Netz gehen – und selbst das ist sehr optimistisch gerechnet. Das heißt: Sie leisten keinen Beitrag zur Lösung der aktuellen Energiekrise und entlasten weder Haushalte noch Unternehmen in absehbarer Zeit. Stattdessen würden Milliarden an Steuergeldern in ein Projekt fließen, das zu spät kommt, den Strom verteuert und die Energiewende unnötig verzögert.
Beitrag zur CO2-Reduktion ja – aber zu welchem Preis?
Zwar kann die Atomkraft kurzfristig zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen – doch dieser Vorteil hat seinen Preis: Atomkraftwerke sind extrem unflexibel und lassen sich kaum bedarfsgerecht regulieren. Das bedeutet, dass sie den Strommix verstopfen und es deutlich erschweren, flexible erneuerbare Energien wie Wind- und Solarstrom effizient zu integrieren. Für eine moderne, resiliente Energiewende, die auf Ausgleich, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit setzt, ist die Atomkraft daher ein Bremsklotz statt ein Baustein.
Fazit: Es ist ein Schritt zurück in die Vergangenheit
Die Rücknahme des Atomausstiegs ist sicherheitspolitisch fahrlässig, ökonomisch unsinnig und energiepolitisch ein Rückschritt. Statt in überteuerte und unsichere Technologie von gestern zu investieren, braucht Belgien einen konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien und der Speichertechnologien – sozial gerecht, wirtschaftlich tragfähig und gesund für Mensch und Umwelt.
Für Ecolo Ostbelgien
Fabienne COLLING
Pascal COLLUBRY
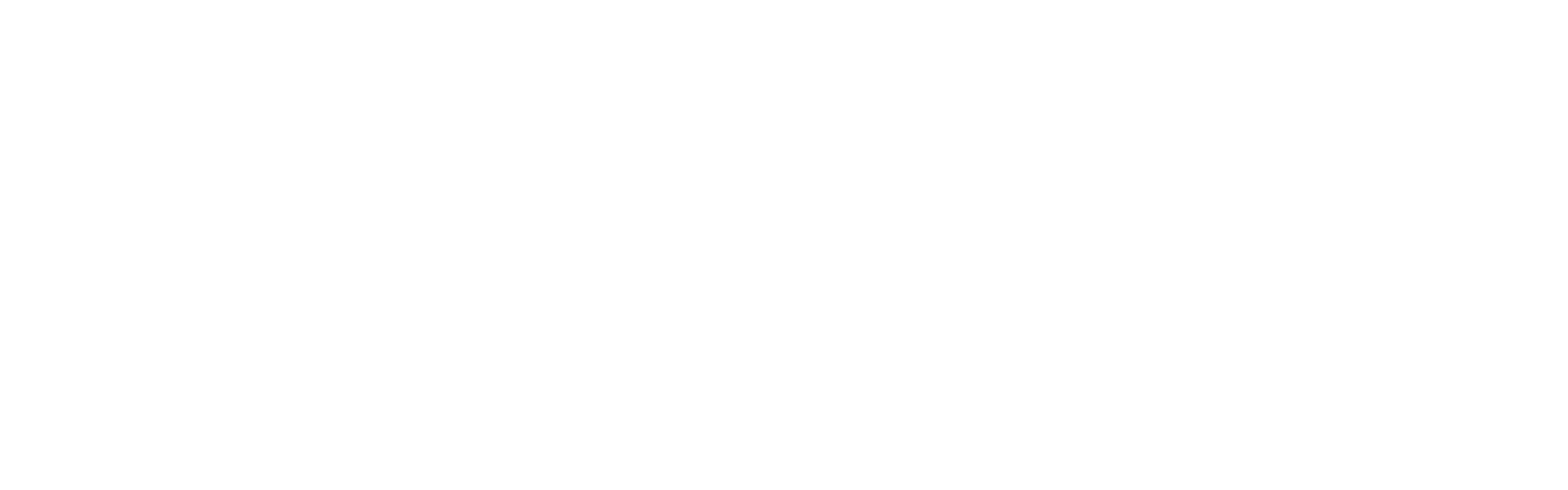

Ich finde diese Entscheidung wirklich erschreckend.
Was können wir tun.
Gehen wir auf die Straße?
Wir müssen unseren Unmut deutlich machen.
Ja, auf die Straße gehen und zwar wieder grenzüberschreitend, da auch in den Niederlanden ähnliche Atompläne da sind. Dort gab es einen Aktionstag dagegen am 17.Mai. Der nächste sollte ein Dreiländeraktionstag sein. Wir alle haben es damals geschafft, dass die Rissreaktoren 23 abgeschaltet worden sind. Wir hätten uns nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen dürfen. Wer was tun will, melde sich auf unserer Webseite. Die hat zwar eigentlich den Schwerpunkt, die geplanten Castortransporte von Jülich nach Ahaus zu verhindern, aber wir wollen auch unseren Teil in der Euregio tun. Strahlung kennt keine Grenzen, Widerstand auch nicht. Martina aus Aachen-Sief (60 km von Tihange)